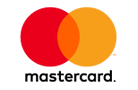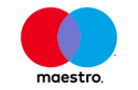Lupus

Lupus bezieht sich meist auf den systemischen Lupus erythematodes (SLE), eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die eigenen Gewebe in nahezu jedem Organ angreift. Lupus ist als „großer Imitator“ bekannt, da er viele andere Krankheiten nachahmen kann – Haut, Gelenke, Nieren, Herz, Lunge, Blutzellen, Gehirn können betroffen sein. Die Krankheit ist durch Phasen der Verschlechterung (Aktivität) und Phasen der Remission gekennzeichnet. Aufgrund des breiten Spektrums an Manifestationen und möglichen Komplikationen (z. B. Nierenversagen aufgrund von Lupus) zählt diese Krankheit zu den schwersten Erkrankungen des Immunsystems.
Lupus-Symptome können sehr vielfältig sein, umfassen aber typischerweise:
- Hautveränderungen: charakteristischer schmetterlingsförmiger Ausschlag im Gesicht (über Nase und Wangen), Lichtempfindlichkeit (ausgeprägte Reaktion auf Sonne), Hautausschläge am Körper.
- Nierenprobleme: Lupusnephritis kann zu geschwollenen Beinen, erhöhtem Blutdruck und Proteinen im Urin führen.
- Müdigkeit und Fieber: chronische Müdigkeit, Abgeschlagenheit und gelegentlich leicht erhöhte Temperatur.
- Nierenprobleme: Lupusnephritis kann zu geschwollenen Beinen, erhöhtem Blutdruck und Proteinen im Urin führen.
- Sonstiges: Brustschmerzen beim Atmen (Pleuritis oder Perikarditis – Entzündung des Lungen- oder Herzbeutels), Kopfschmerzen, Verwirrtheit oder andere neurologische Beschwerden.
Die Ursache von Lupus ist ebenfalls noch nicht vollständig geklärt. Eine genetische Prädisposition in Verbindung mit Auslösern wie Infektionen, Sonnenlicht oder Stress kann dazu führen, dass das Immunsystem die Toleranz gegenüber den eigenen Zellen verliert. Beim SLE werden Autoantikörper gebildet, die Immunkomplexe bilden und chronische Entzündungen in verschiedenen Geweben verursachen. Infolgedessen kommt es zu Gewebeschäden, wobei oxidativer Stress die Schäden zusätzlich verschlimmert – Entzündungen erzeugen freie Radikale, die Zellmembranen in Organen (z. B. Nieren) schädigen. Ein immunologisches Ungleichgewicht ist zentral: ein überaktives und „verwirrtes“ Immunsystem greift auch gesunde Zellen an, während gleichzeitig die Fähigkeit des Körpers, sich gegen äußere Infektionen zu verteidigen, aufgrund der Erschöpfung des Immunsystems verringert sein kann.
Natürliche Unterstützung für den Organismus
Menschen, die an Lupus erkrankt sind, suchen oft nach Wegen, um Entzündungen durch die Ernährung zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit des Körpers zu stärken. Dinkel kann vielfältige Vorteile bieten. Seine Antioxidantien (Vitamin E, Vitamin C, Selen, Flavonoide) helfen, oxidativen Stress zu neutralisieren und schützen so Organe (wie Nieren und Blutgefäße) vor Schäden. Die entzündungshemmende Wirkung der Nährstoffe aus Dinkel kann zur Beruhigung von Gewebereizungen beitragen: Zum Beispiel wirken Omega-3-Fettsäuren (falls im Nahrungsergänzungsmittel enthalten) und Chlorophyll entzündungshemmend.
Chlorophyll aus Gründinkel-Saft hat auch antibakterielle Eigenschaften und kann daher helfen, Infektionen vorzubeugen, was wichtig ist, da Lupus und seine Behandlung (Kortikosteroide, Immunsuppressiva) das Immunsystem schwächen können. Dinkel ist reich an hochwertigen Proteinen und essentiellen Aminosäuren, was die Regeneration von durch die Krankheit geschädigten Zellen und Geweben unterstützt. Regelmäßiger Dinkelkonsum liefert auch die notwendigen B-Vitamine (wie B6 und Folsäure), die für die ordnungsgemäße Blutbildung und die Funktion des Immunsystems wichtig sind.
Bei Lupus treten häufig auch Anämie oder Eisenmangel aufgrund der chronischen Krankheit auf – Dinkel kann mit seinem Eisen- und Kupfergehalt zur Verbesserung des Blutbildes beitragen. Auch die Verbesserung der Verdauung und Nährstoffaufnahme dank der Dinkelballaststoffe kann den Körper stärken, da Lupus-Patienten während schwerer Krankheitsepisoden manchmal an Gewicht verlieren und unter Nährstoffmangel leiden. Kurz gesagt, Dinkel hilft dem an Lupus erkrankten Körper, Entzündungen zu bekämpfen, schützt die Zellen vor oxidativen Schäden und trägt zur allgemeinen Widerstandsfähigkeit des Organismus bei.